
Weitere Templerorte in Deutschland
Ich wurde vor einigen Tagen von einem Leser meiner Seite angesprochen, ob ich denn noch nichts von den Templerkirchen in Süpplingenburg und Mücheln gehört hätte, wenn ich schon über die Templer in Deutschland Untersuchungen anstellen würde. Meine diesbezügliche Seite von 2006 hatte da noch die Überschrift Templer in Deutschland. Ich hab das jetzt geändert und möchte an dieser Stelle allgemein darauf hinweisen, dass es schwer bis unmöglich ist, einen auch nur einigermassen kompletten "Katalog" von Templerniederlassungen herzustellen. Mein Leben würde dafür nicht ausreichen, es sei denn, das mit dem Lottogewinn würde endlich einmal klappen.
Jeder Autor, der sich mit dem Thema befasst, stösst irgendwann einmal an diese Grenze. Zum einen wird man feststellen müssen, dass reine Schreibtischarbeit nicht ausreicht, weshalb ich mich schon von Anfang an dazu entschieden habe, nur von solchen Orten zu berichten, die ich selbst bereist habe. Zum anderen muss man eine Vorauswahl der Orte treffen, die in einen solchen Katalog aufzunehmen sind. Manche Autoren listen Ortsnamen auf, in denen den Ordensrittern vielleicht nur mal eine Mühle oder ein Acker gehört hat, andere Autoren bezeichnen jede Templerkapelle schon als Komtureisitz. Es gibt brauchbare und fast komplette regionale Untersuchungen (z.B. Legras für die Charente und Miguet für die Bourgogne) und unzählige Bemühungen um einigermassen vollständige Listen im Internet, etwa die Site meines Bekannten Christophe Staf: www.templiers.org oder diese Site: www.templiers.net, dessen Betreiber leider auf Zuschriften nicht reagiert. Aber auch die Verfasser dieser Sites haben keine Chance, alle die beschriebenen Orte persönlich aufzusuchen und die in der Literatur gehandelten Angaben vor Ort zu überprüfen. Ein kompletter Templerkatalog wäre eine grosse Herausforderung, ein rechtes Jahrhundertwerk, und ich bedauere, dass ich erst so spät damit angefangen habe.
Aber zurück zum Thema. Ich nahm den Hinweis gerne auf und benutzte eines der Wochenenden mit sog. Brückentag dazu, den längst überfälligen Abstecher zu den Templern nach Norddeutschland zu machen.
1. sog. "Tempelhaus" in Hildesheim
Ob die Templer überhaupt jemals in Hildesheim ansässig waren, ist in der Literatur seit langem umstritten: www.templerlexikon.uni-hamburg.de/Hildesheim.pdf. Das an dem wunderschönen Marktplatz von Hildesheim stehende Tempelhaus, das früher im Volksmund auch Tempelherrenhaus genannt wurde ist sehr beeindruckend, hat aber wohl nichts mit dem Tempelorden zu tun ( http://de.wikipedia.org/wiki/Tempelhaus_%28Hildesheim%29). Es ist erst nach dem Ende des Templerordens erbaut worden, steht aber an der Stelle eines früheren Gebäudes. Die meisten Wissenschaftler geben auf Volksmund-Erwähnung nichts, wenn es keine entsprechenden Urkunden oder Dokumente gibt. Natürlich sind viele Urkunden verloren gegangen und gerade im Zusammenhang mit dem untergegangenen Ritterorden wahrscheinlich sogar absichtlich unterdrückt worden und so gibt es - nicht nur in Deutschland - einige Unklarheiten, wie der Volksmund dazu kommt, manche Gebäude beharrlich den Templern zuzuordnen, obwohl wissenschaftliche Beweise fehlen. Wir sehen das Phänomen in Deutschland etwa auch noch bei dem Tempelherrenhaus in Köln (nicht mehr vorhanden) und in zwei Orten des Odenwaldes, Weinheim (Nachfolgerbau erhalten) und Amorbach (Original erhalten, eines der ältesten Fachwerks- und Profanbauten in Deutschland) und eben hier in Hildesheim:

sog. "Tempelhaus", 31134 Hildesheim
Es war sehr schön auf diesem Marktplatz, ein mit Schnitzereien überladenes Fachwerkhaus stiehlt dem nächsten die Schau, traumhaftes Wetter und ein Jahrmarkt, der keine Wünsche offenliess. Ich machte mich auf zu meinem Nachtquartier in Königslutter. Dort gibt es einen Kaiserdom, mit einem der wohl eigenwilligsten romanischen Portale Deutschlands.

Basilika, 38154 Königslutter
und eine Stadtkirche, die mit "Templerornamenten bespickt" ist, aber nach Aktenlage wohl nichts mit dem Templerorden zu tun hatte.

Agnus Dei und "Templerkreuz", Stadtkirche, 38154 Königslutter

Steinkreuz, Stadtkirche, Königslutter
Solche wohl als Grenzsteine benutzten Steinkreuze habe ich in der Nähe von Templerniederlassungen im Languedoc gefunden. Ich halte das hier nur fest und möchte damit nicht etwa zur Bildung von Legenden beitragen. Auf dem Marktplatz von Königslutter steht ein Mast mit den Winpeln und Wappen von Vereinen und der umliegenden Orte. Der Ort Gross-Steinum hat etwa als Wappen das Malteserkreuz der Johanniter, weisses Zackenkreuz auf rotem Grund. http://www.gross-steinum.de .
2. Süpplingenburg
Am nächsten Morgen traf ich mich mit meinem "Informanten" in der einige Kilometer von Königslutter entfernten Ortschaft Süpplingenburg, Herrn Michael Stiewe, der vor Ort gern äusserst sachkundige Führungen - natürlich nach Anmeldung - übernimmt und der praktisch jeden Stein der Templerkirche in Süpplingenburg kennt. Sein Enthusiasmus, seine Sachkunde und seine regelrechte Leidenschaft für die Historie seiner Heimatstadt formt in mir den innigen Wunsch, dass sein Traum von einem kleinen Heimatmuseum unter seiner Leitung mit Unterstützung der richtigen Personen dereinst einmal Wirklichkeit werden möge. Die Gemeinde hätte einen grossen Nutzen davon, denn die Templerkirche von Süpplingenburg ist eine echte Attraktion, die viel zu wenig beworben und bekannt gemacht wird.

St. Johannes-Basilika, 38376 Süpplingenburg

Dieser Ausschnitt der Südfassade zeigt orientalisch anmutende Köpfe. Nach Ansicht des Autors Friedrich Bernd weisen diese noch erhaltenen Schmuckformen auf die Templer hin. Man erkenne spätantike, orientalische und normannische Einflüsse an den Gesichtszügen, Barttrachten und Kopfbedeckungen (Bernd, Friedrich, Die Stiftskirche und spätere Ordenskirche der Tempelritter auf der Stammburg Kaiser Lothars von Süpplingenburg, in Braunschweigisches Jahrbuch, Band 63, S. 31ff, S. 41. Der Aufsatz wurde mir freundlicherweise von Michael Stiewe überlassen .

Detail vom Nordportal
Dieses Foto zeigt sicher kein Ornament aus der Templerzeit. Die Arbeit ist vergleichsweise modern. Die neuzeitlichen Steinmetze könnten sich aber am vorher dort vorhandenen Ausgangsmaterial orientiert haben und das könnte für mich eine lange schon offene Frage bezüglich der Ornamente der Templer - falls es so etwas überhaupt gibt - klären. Die runden Ornamente stellen offensichtlich eine geschlossene und eine sich gerade schliessende Blüte dar, nach Meinung Michael Stiewes ein Symbol für Alpha und Omega, den Beginn und das Ende des Seins. Der Sichtweise schliesse ich mich gerne an und verweise auf ein damit wohl endlich zu klärendes Ornament der Templerkapelle in Cressac:

Fresko, 13. Jh.
chapelle des Templiers de Cressac, Cressac-St. Genis, 16 Charente
Die Ähnlichkeit der beiden kreisförmigen Symbole mit den Punkten in den unteren Kreuzvierteln und dem oben gezeigten Portal dürfte eine schlüssige Erklärung liefern, dass hiermit ebenfalls Blüten symbolisiert werden sollten. Es ist mindestens eine brauchbare Hypothese.
Weltweit einzigartig dürfte folgendes Ornament an der Decke des südlichen Querhausflügels sein: Vier sogenannte Patriarchenkreuze, ins Kreuz zueinander gestellt.

Decke des südl. Querhausflügels, Basilika Süpplingenburg
Zum Schluss noch ein Blick in das innere der recht bunt gestalteten Basilika. Die Neigung der Wände zeigt, dass die Erbauer hier gegen einen anspruchsvollen Untergrund anzukämpfen hatten. Süpplingenburg kommt von Sumpf. Nicht das erste mal, dass die Templer solch problematisches Terrain "erbten" und gezeigt haben, dass sie mit den Tücken ganz gut zurechtkamen. Der Autor Bernd (aaO) meint, hier armenische Architekturelemente zu erkennen.

Es wurde Zeit, hier aufzubrechen und dem Land Niedersachsen den Rücken zu kehren, denn ich hatte vor auf der Rückfahrt nach Frankfurt noch eine Templerlocation in Sachsen-Anhalt zu besichtigen, was ich ebenfalls schon lange vorhatte.
3. Mücheln
Über Helmstedt fuhr ich also zunächst nach Osten, vorbei an den Templerorten Haldensleben und Magdeburg, die ich dieses Mal nicht besuchen konnte, und dann nach Süden, Richtung Halle. Mücheln ist wohl die am besten in ihrem Originalzustand erhaltene Templerkirche in ganz Deutschland. Die Bauzeit wird mit 1260 bis 1280 angegeben (Lehmann - Patzner, die Templer in Mitteldeutschland, S. 87). Der Baustil des Kirchengebäudes ist rein gotisch. Lediglich die Architektur des Dachstuhls erscheint mir nachträglich errichtet.

Liebfrauenkirche Mücheln, 06198 Wettin

Templerkirche Mücheln, Westfassade mit (begehbarem) Treppenturm

Fresko im Innern

Ostchor

gotisches Südportal
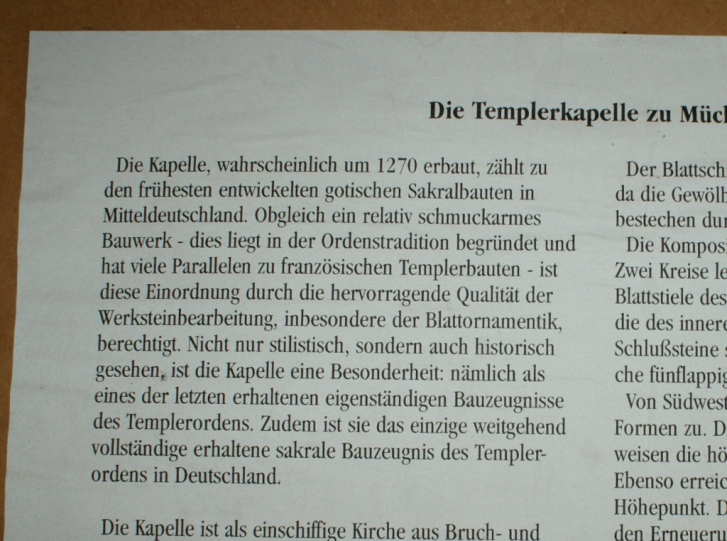
Beschreibung im Dachstuhl des Gebäudes