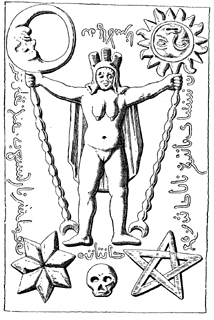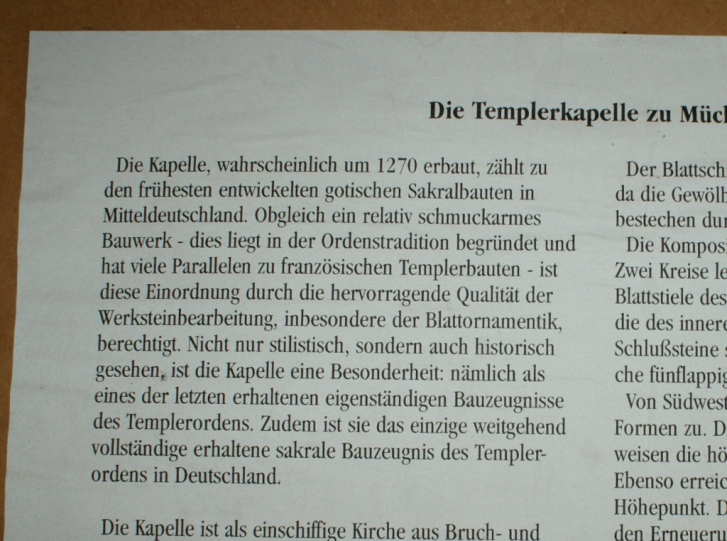Angebliche „Templerorte“ in Deutschland
Während meine bisherigen Beiträge von der Bemühung gekennzeichnet waren, sich ausschliesslich auf wissenschaftlich erwiesene Templerbesitzungen zu beziehen, habe ich versucht, mich in diesem Beitrag auch ein wenig dem Phänomen der Legenden zu nähern. Insbesondere in Deutschland scheint es ein Problem mit nur angeblichen Tempelhäusern zu geben. Zumeist heisst es, der „Volksmund“ sei für die Legendenbildung verantwortlich. Ich hatte das schon für das sog. Tempelherrenhaus in Hildesheim und das sog. Templerhaus in Amorbach gezeigt. Nachvollziehbare Gründe, warum sich der Volksmund so etwas ohne jeglichen Anlass ausdenken sollte, werden oft nicht genannt. Das ist für mich genug Anlaß, solchen Gerüchten zweimal im Detail nachzugehen.
1. Das sogenannte Templerhaus in Köln
Eine Geschäftsreise bot Gelegenheit, das sog. Tempelhaus in Köln aufzusuchen. Das Haus soll ca. 1230 vermutlich von der Familie Overstolz errichtet (Overstolzenhaus Wikipedia) und seither mehrfach umgebaut worden sein. Es befindet sich in der Rheingasse, Hausnummer 8:
Warum sich die Legende gebildet hat und hartnäckig hält, dass dieses prächtige Gebäude mit dem Templerorden in Verbindung zu bringen sei, ist nicht befriedigend zu beantworten. Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich ein solcher Bezug nicht beweisen. Dass die Templer in Köln jedoch (mindestens?) ein Haus besessen haben, wurde jedoch auch von den Wissenschaftlern im 19. Jahrhundert übereinstimmend angenommen (von Ledebur, Die Tempelherren und ihre Besitzungen im Preußischen Staate, 1835, S. 114, Nachdruck bei LePa und Wilcke, Die Geschichte des Ordens der Tempelritter, 1860, S. 388) und wird offenbar auch bis heute noch so gesehen (Anke Napp, Templerlexikon Uni Hamburg).
Weyden (Ernst Weyden, Das Haus Overstolz zur Rheingasse genannt Tempelhaus, Köln 1842, S. 18) bestreitet entschieden, dass die Templer mit diesem Haus irgend etwas zu tun gehabt haben können. Er führt die Neigung des Volksmunds, dieses wie angeblich andere alte Häuser in Köln als „Tempelhäuser“zu bezeichnen, auf den Umstand zurück, dass diese oft einen „alterthümlichen … geheimnisvollen Baustil“ (a.a.O., S. 19) aufgewiesen hätten. Vorzugsweise das Haus „zur Rheingasse“ soll der Volkmund den Templern zugeschrieben haben, weil es sich durch die „Grossartigkeit seines Baustils“ (ebenda) und den „Reichthum seines Giebelwerkes“ besonders auszeichnete (ebenda). Im übrigen kämen die Namen „Templerhaus“ oder „Templerhof“ in Köln nie urkundlich vor (ebenda). Dennoch ist Weyden präzise in der Lage, ein ehemaliges Anwesen in der Streitzeuggasse, Hsnr. 86-88, als Templerhaus zu identifizieren (a.a.O., S. 18). Weyden, der den Ursprung dieses Hauses in der Familie Overstolz sieht, muss allerdings einräumen, dass der wahre Erbauer des Hauses sich ebenfalls nicht in Urkunden finden lässt, weil sich diese nur bis 1210 zurückverfolgen liessen (S. 22). Aufgrund der Grossartigkeit des Hauses komme nur ein „reiches, angesehenes Geschlecht“ in Betracht (ebenda). Allerdings sei ein Geschlecht derer „zur Rheingassen“ ab 1169 urkundlich nachweisbar. Dieses Geschlecht muss besonders wohlhabend gewesen sein, weil es regelmässig Schöffen stellte, was nur den edelsten Familien vorbehalten geblieben sei (ebenda). Das Geschlecht der Overstolzen habe sich zuerst den Beinamen „zur Rheingasse“ beigelegt, deshalb müssen die Overstolzen als die Erbauer dieses prächtigen Hauses gelten (ebenda). Die Overstolzen seien wohl das mächtigste Geschlecht in Köln gewesen – Weyen vergleicht ihre Rolle mit denen der Medici in Florenz (S. 28) – aber auch in recht handgreifliche Meinungsverschiedenheiten mit anderen Machthabern (etwa dem Erzbischof, S.30) geraten.
Möglicherweise ergibt sich der Bezug dieses Hauses zum Templerorden jedoch aus folgendem, heute von mir rechnerchierten Sachverhalt, der die Deutung als Besitz der Familie Overstolz nicht ausschliesst. Nach neueren Forschungen sei das romanische Patrizierhaus mit den markanten Stufengiebeln etwa 1230 von Blithildis Overstolz errichtet worden (wiki/Overstolzenhaus). Diese hatte den Ritter Werner von der Schuren (ein Adelsgeschlecht aus dem Raum Köln und Umgebung) geheiratet, der den Namen Overstolz bei der Hochzeit mit Blithildis angenommen hatte (a.a.O). Das Haus hieß damals dennoch in den Schreinsbüchern bis 1257 „Haus zur Scheuren“ (ad horreum) und besaß damit den ursprünglichen Namen des Ritters Werner von der Schuren (a.a.O). Dieser Name taucht bei Weyden überraschenderweise garnicht auf. Entweder ist das von ihm übersehen worden. Oder er wollte seine durchaus nicht lückenlos überzeugende Argumentation nicht ins Wanken bringen. Es gelang mir zudem, in der Tat recht enge Geschäftsbeziehungen der Familie von der Schuren mit den Templern nachzuweisen. So hat sie „mit den Templern in Verhandlung um Grund und Boden unter welfischer Zeugschaft“ gestanden ( v. Hormeyer, Die Bayern im Morgenlande, München 1832, S XX ). Vielleicht ist das eine Spur, die an der Legendenbildung mithalf.
Foto: Markus Menzendorff Lithografie um 1843 von August Schott – Rheinisches Bildarchiv
2. Das sogenannte Tempelhaus in Erbach
Wir benutzen einen schönen Tag im Mai für einen Ausflug in den Odenwald, auch um das dortige angebliche Templerhaus näher zu untersuchen. Postalische Anschrift: Städtel 15a und 21, 64711 Erbach. Ansicht von aussen auf die Altstadt:
Ansicht von der Stadtseite:
„Das Tempelhaus gehörte zu der Ansiedlung von Burgmannen vor der Burg, dem historischen Kern der mittelalterlichen Stadt Erbach, umschlossen von Armen der Mümling im Bereich der heutigen Straße Im Städtel. Burgmannen werden in Erbach urkundlich 1303 als Castrenses greifbar, namentlich erstmals 1372 erwähnt.“ Wikipedia Tempelhaus Erbach.
Ein Bezug zu dem Templerorden ist urkundlich nicht nachweisbar. Überhaupt liegt die Entstehungsgeschichte des Hauses noch immer ziemlich im Dunklen:
„Forschungsstand vor der Durchführung der Untersuchung:
Es existierte kaum gesichertes Wissen über Ursprung, Alter und Geschichte des Hauses. Datierungsvorschläge: vom 13. bis zum 15. Jahrhundert; Der heutige Gebäudekubus galt als eine Erweiterung des alten Wehrturms. Obgleich im erst 18. Jahrhundert das Gebäude erstmals als „Tempelhaus“ bezeichnet wurde, brachte man den Bau mit dem Tempelorden und den Johannitern in Zusammenhang. Unbestritten befand sich das Haus als „Steinernes Haus im Echterischen Hof“ lange Zeit im Besitz der Familie Echter von Mespelbrunn. Die Nachfolge der erbenlosen Familie Echter traten ab 1676 die Grafen Erbach an.“ Fraunhofer IRB
Woher kommen solche Zuschreibungen des Volksmundes? Legenden, sagen die Wissenschaftler. Aus ihrer Sicht natürlich zurecht. Die Einstufung eines Gebäudes als dem Templerorden zugehörig ist nur statthaft, wenn belastbare Beweise gefunden worden sind. Urkunden, Prozessakten, Briefe, Katasterbezeichnungen, Orts- und Strassennamen, alte Landkarten, Grenzsteine oder andere (archäologische) bauliche Befunde kommen hierzu in Betracht. Keine Urkunde – kein Templerhaus! So einfach ist das aus wissenschaftlicher Sicht. Was ist aber mit den Legenden? Sind sie keinerlei Beachtung würdig? Der Volksmund sagt bekanntlich auch: Kein Rauch ohne Feuer. Ist also doch irgendetwas dran an diesen Legenden? Oder kommt der „Volksmund“ durch nichts und wieder nichts auf solche dann absurden Ideen?
Ich fühle mich natürlich auch eher einer auf Fakten basierenden Erkenntnis verpflichtet, sehe aber keinen Grund, nicht doch zwei Deutungsversuche zu dieser Frage zu wagen:
Einerseits ist gerade bei dem Beispiel Erbach auffällig, dass offensichtlich erst ab dem 18. Jahrhundert urkundliche Erwähnungen des Namens Tempelhaus auftauchten. Dieser Befund ist offenbar auch bei anderen sogenannten Tempelhäusern in der näheren Umgebung festzustellen:
„Die regional häufige Bezeichnung als Templerhaus findet sich ebenso in Erbach, ehemalige Templerhäuser haben existiert in Neckarelz, Uissigheim und Kleinwallstadt. Die große Zahl steht im Widerspruch dazu, dass der Templerorden in Deutschland kaum vertreten war. Meist entstanden die Bezeichnungen erst in der Neuzeit, beim Amorbacher Templerhaus geht sie auf eine Beschreibung Amorbachs von 1856 zurück.“ Wikipedia Amorbach
Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts kam es in bestimmten Zirkeln (mit unterschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Zielsetzungen und Interessen) groß in Mode, sich des Templerordens zu entsinnen. So beschäftigte sich etwa der bekannte deutsche Schriftsteller, Verlagsbuchhändler und Freimaurer Friedrich Nicolai (1733 – 1811) ab 1782 mit den Mythen um die Templer und untersuchte Bezüge zum Freimaurertum (Loiseleur, Jules, La Doctrine Secrète des Templiers, 1873, S. 107). Besonders setzte sich ein österreichischer Diplomat und Orientalist namens Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall (* 9. Juni 1774 † 23. November 1856 in Wien) mit doch sehr abwegigen und kruden Thesen über die Templer in seinem Traktat Die Schuld der Templer, Wien, 1855 in erbitterten Widerstreit mit z.B. französischen Historikern wie Michelet und Raynouard. Sein Buch enthält gezeichnete Abbildungen von Reliefs, wie u.a. dieses:
Hammer-Purgstall bezeichnet seine – wie zu erwarten – sehr umstrittenen Zeichnungen als archäologische Beweise der Götzendienste der Templer. Eins dieser Reliefs soll ein Kästchen aus Kalkstein geziert haben, das in der Gemeinde Essarois (21, Côte-d’Or) gefunden worden sei. Dieser Ort befindet sich tatsächlich in unmittelbarer Nachbarschaft der bekannten Templerorte im Bistum Langres, Voulaines-les-Templiers und Bure-les-Templiers (ca. 15-20 Km). Das ist aber auch schon alles. Die Kunstfertigkeit und Darstellungsweise enstpricht in keiner Weise dem, was ich an Steinmetzarbeiten aus dem Mittelalter allerorts gesehen und zum grossen Teil in dieser Webseite dargestellt habe. Was auch immer das gewesen sein soll, es beweist nichts. Zumal die Sammlung des Duc de Blacas, in der sich diese Skulptur befunden haben soll, sich nicht mehr besichtigen lässt. Sie existiert nicht mehr (Loiseleur, S. 120).
Ich will mich diesem obsoleten Meinungsstreit an dieser Stelle nicht weiter widmen. Man sieht jedoch, dass die Phantasie der Menschen im 18. und 19. Jahrhundert – aus welchen Gründen auch immer – durch die Templer und ihr bis heute noch in vielem rätselhaftes Schicksal regelrecht befeuert wurde (vgl. Barber, die Templer, S. 285ff.). Und so mag das vielleicht ein Grund dafür gewesen sein, dass man dem einen oder anderen Haus, dessen Grundsteinlegung im Mittelalter erfolgte, und über das nicht alles aus Urkunden bekannt war, eine Templerlegende andichtete.
Andererseits mag es auch gute Gründe dafür gegeben haben, dass sich – besonders in Deutschland – Urkunden über Templerbesitzungen oft nicht finden lassen. Der Papst verfügte zwar 1314, dass die Güter der Templer im wesentlichen (ausgenommen derer, die sich auf der iberischen Halbinsel befanden) den Johannitern zu übergeben seien (Wilke, S. 605). Allerdings erfolgte die Übernahme in der Praxis keinswegs unproblematisch, insbesondere in dem politisch zersplitterten Deutschland nicht. So habe sich manche Privatperson den den Johannitern mit Rechtsstreitigkeiten widersetzt (a.a.O. S. 606 f.). Mächtige Dynasten erzwangen sich den Besitz an Templerburgen. (a.a.O. S. 609). Auch Landesherren und Klöster gingen nicht leer aus (ebenda).
So dauerte es bis in die fünfziger Jahre des 14. Jahrhunderts, bis der Besitzübergang mancher Templerstätten in Deutschland auf die Johanniter als Rechtsnachfolger vollzogen war. Zielenzig gelangte 1350, Süpplingenburg erst 1357 in die Hände von Foulques de Villaret, Großmeister der Johanniter zu der Zeit (Sarnowsky, S. 84 (in: Die Johanniter: ein geistlicher Ritterorden in Mittelalter und Neuzeit, Beck Verlag, 2011). Manche Güter der Templer wurden schlichtweg von den Erben der Stifter eingezogen oder gar von Fürsten zur Weitergabe an Günstlinge enteignet (aaO). Das Klammern an Urkunden bringt bei solchen Vorgängen nicht viel ein. Denn Urkunden wurden im Mittelalter bekanntlich sehr häufig gefälscht oder vernichtet.
„Zeitweilig wurden ganze Serien von Falsifikaten hergestellt, z.B. durch den Bischof Pilgrim von Passau (971-991) und in der Abtei Fulda (um 1200) durch den Mönch Eberhard, der mit großer Geschicklichkeit die rechtliche Aufbesserung von alten Urkunden in Königsurkunden vornahm. Auch das Kloster Reinhardsbrunn in Thüringen, von dem 13 Falsifikate bekannte sind, stellte sich im 12. Jhdt., wenn auch vergebens, mit verfälschten Urkunden einer Gründung des Klosters Georgental in unmittelbarer Nachbarschaft entgegen, um diesen unliebsamen Konkurrenten auszuschalten. Vom Berger Kloster in Altenburg sind 23 Falsifikate bekannt. Sie reichen von der gefälschten, allerdings auf echter Grundlage beruhenden Gründungsurkunde über die gefälschte Hochgerichtsbarkeit bis zu fingierten Abgabeerhöhungen. In vielen Fällen wurde einer Fälschung eine andere entgegengesetzt, oder, wie es Hinkmar von Reims im 9. Jhdt mit Witz und Scharfsinn tat, die gleiche nochmals verändert. Doch nicht alle Schreiber, die eine Urkunde fälschten oder „verunechteten“, waren sich eines Verstoßes gegen die bestehende Rechtsordnung bewusst, obwohl auch im MA Urkundenfälschungen unter Strafe gestellt waren, wie u.a. der Schwabenspiegel und besonders auch das kanonische Recht ausweisen. Und trotzdem sind uns aus dieser Zeit nur wenige Strafprozeßakten, gemessen an der hohen Zahl der Fälschungsdelikte, überliefert“ (aus: Quirin, 1985, Bemerkungen zum Problem der Urkundenfälschung im Mittelalter).
Nach alledem lässt sich nicht ausschliessen, dass der Volksmund sich im Hinblick auf das eine oder andere „angebliche“ Templerhaus noch zurecht an die früheren Herren erinnerte. Und dass diese Erinnerung die Zeiten überdauerte und sich nicht darum scherte, dass irgendeine neue Herrschaft frühere Templerbesitzungen mit allen erdenklichen redlichen oder unredlichen Mitteln an sich gerissen haben mag.
Mit solchen Überlegungen alleine lässt sich nichts gewinnen, das ist pure Spekulation. Die Forschung wäre aber gut beraten, mehr über den Ursprung der Legenden in Erfahrung zu bringen, bevor man so etwas als unbeachtlich abtut. Steht fest, dass die Erwähnungen tatsächlich erst im 18. Jh. einsetzen, so wird es sich wohl nur um eine romantische Zuordnung der genannten Modewelle handeln. Die Aufklärung, aber auch das Freimaurertum und die Romantik machten die Templer, die seit der Vernichtung ihres Ordens dem Vergessen oder der Verachtung anheimgefallen waren, erst wieder salonfähig. Reichen die Volksmund-Zuordnungen bis ins ausgehende Mittelalter oder in die beginnende Neuzeit zurück, muss man die Sache gewiss ernster nehmen und die Quellen sorgfältig und ergebnisoffen studieren.
Was gab es sonst noch zu sehen, in der Gegend vom Erbacher sogenannten Templerhaus?
Eine römische Villa aus dem 2. Jahrhundert, anzusehen in einem schönen Freilichtmuseum:
 Römische Villa Haselburg, 64739 Höchst im Odenwald
Römische Villa Haselburg, 64739 Höchst im Odenwald
 rätselhaftes Detail der Anlage (wofür das wohl gut war? )
rätselhaftes Detail der Anlage (wofür das wohl gut war? )
Und ein paar Kilometer weiter dieses Kleinod, oder eher ein „Großod“
Die Einhardsbasilika in Steinbach, einem Ortsteil von Michelstadt im hessischen Odenwald, ist ein Kirchenbau aus dem 9. Jahrhundert. Die gut erhaltene Basilika gilt als außergewöhnliches Bauwerk und wegen des noch zum Großteil erhaltenen karolingischen Mauerwerks im Bereich des Mittelschiffs, des nördlichen Nebenchors und der Krypta als eines der wenigen Beispiele karolingischer Baukunst in Deutschland. Ihr Name bezieht sich auf ihren Erbauer Einhard, den Ratgeber Karls des Großen und Ludwigs des Frommen. (wikipedia)